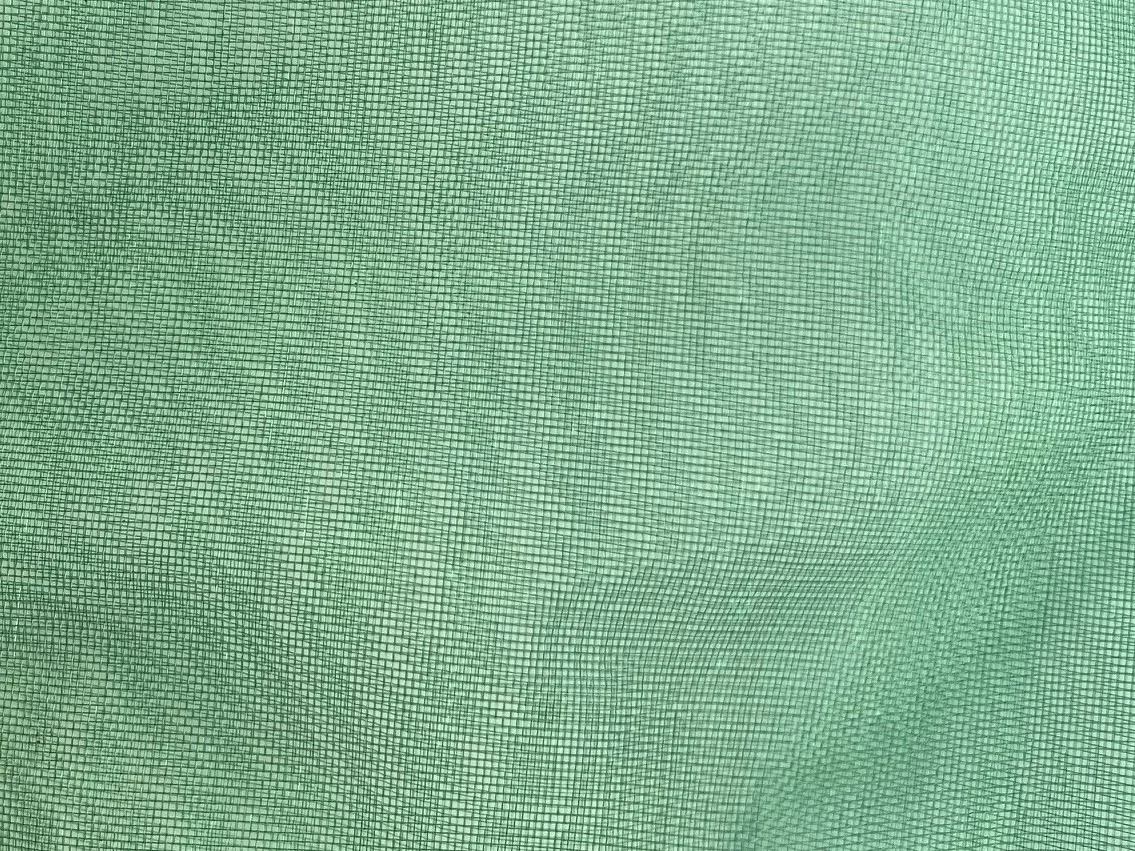Netze und Zäune verwenden, ohne Tieren zu schaden
Beim Einsatz von Zäunen und Netzen sollten ein paar wichtige Grundsätze beachtet werden. So lässt sich verhindern, dass Tiere sich verletzen oder sterben. Dieser Artikel behandelt das Thema für Haus- und Familiengärten, Alp- und Landwirtschaft werden hier nicht behandelt.
Probleme bei der Nutzung von Zäunen und Netzen
Zäune und Netze stellen für Wildtiere Hindernisse und Gefahren dar. Oft werden sie nicht rechtzeitig erkannt. Tiere können sich darin verfangen, was nicht selten tödlich endet. Betroffen sind nicht nur Kleintiere wie Igel, Eidechsen und Vögel, sondern auch Rehe, Hirsche und Gämsen. Die Tiere verletzen sich beim Fluchtversuch, sterben durch Erschöpfung oder strangulieren sich. Stacheldraht ist schlecht sichtbar und führt zu schweren Verletzungen. Jährlich sterben in der Schweiz zwischen 3’000 und 4’500 Wildtiere in Zäunen und Netzen. Auch wenn Zäune und Netze im Haus- oder Familiengarten weniger eingesetzt werden als in der Landwirtschaft, sind sie trotzdem eine Gefahr für Tiere.
Grundsätze
- Notwendigkeit prüfen: Netze und Zäune sollen nur verwendet werden, wenn es wirklich notwendig ist. Sobald sie nicht mehr gebraucht werden, müssen sie wieder weggeräumt werden.
- Sichere Lagerung: Zäune und Netze nicht im Freien lagern – auch aufgerollt können sie zur tödlichen Falle werden.
- Sofortige Hilfe: Wird ein Tier gefunden, das sich verfangen hat, soll es unverzüglich befreit werden. Verletzte oder tote Tiere müssen sofort der Wildhut gemeldet werden.
- Rechtliche Verantwortung: Wer Netze und Zäune unsachgemäss verwendet und sie nicht regelmässig kontrolliert, macht sich strafbar.
Zäune
Für Wildtiere gleichen unsere Gärten einem Labyrinth aus Zäunen und anderen Hindernissen. Weidennetze (flexibles Geflecht aus Kunststoffschnüren) und Knotengitter sind für die meisten Todesfälle bei Tieren verantwortlich. Stacheldraht birgt ein hohes Verletzungsrisiko. Tierfreundlicher sind Litzenzäune, Zäune mit mehreren parallel gespannten Drähten. Fix montierte Zäune sind eventuell baubewilligungspflichtig, erkundigen Sie sich vorgängig bei der Gemeinde. Manchmal gibt es auch weitere Einschränkungen. In der Stadt Luzern z. B. sind Zäune in Familiengärten nur an der Areal-Aussengrenze erlaubt. Am besten wählen Sie Zäune aus natürlichen Rohstoffen wie unbehandeltem Holz oder Weidenruten.
- Vermeidung von Fallen: Auf U-förmige Grundrisse oder spitze Winkel verzichten.
- Freie Abschnitte: Zwischen umzäunten Flächen sollen immer wieder Abschnitte ohne Zaun sein, damit Wildtiere wandern können.
- Sichtbarkeit erhöhen: Blaue oder blau-weisse Flatterbänder oder ein durchgehendes Warnband machen den Zaun für Wildtiere sichtbar. Gut sichtbare Farben verwenden (Blau oder Weiss). Orange, Rot oder Gelb sind für Wildtiere schlecht sichtbar.
- Abstand zwischen Boden und Zaun: Ein Zaun sollte für Wildtiere möglichst durchlässig sein. Maschendrahtzäune sollten zwischen Boden und Unterkante 10-15 cm Abstand haben.
- Verzicht auf Stacheldraht: Der Zaun soll keine Tiere oder Menschen verletzen, daher auf Stacheldraht verzichten.
- Weidenetze vermeiden: Weidenetze sind keine dauerhaften Zäune, sie sollen nur kurz oder am besten gar nicht verwendet werden.
- Litzenzäune: Als fixe Zäune eignen sich Litzenzäune mit ein bis zwei Litzen (waagrecht gespannte Drähte). Drei und mehr Litzen sind problematisch. Die unterste Litze soll mindestens 25 cm über dem Boden sein, damit kleinere Wildtiere unten durchschlüpfen können. Die Stromstärke den Weidetieren anpassen, abstellen wenn keine Tiere auf der Weide sind.
- Keine Zäune in Waldnähe: In der Nähe von Waldrändern wandern besonders viele Tiere. Daher am besten auf Zäune in der Nähe von Wäldern ganz verzichten. Ansonsten gelten die Regeln aus dem Merkblatt «Zäune und Wald» (LAWA).
- Regelmässige Pflege: Zäune so unterhalten, dass sie nicht einwachsen können, daher regelmässig freimähen.
Netze
In Netzen, die Obst oder Beeren schützen sollen, können zu Fallen werden. Igel, Vögel, Reptilien und Säugetiere verheddern sich darin. Vor dem Einsatz von Netzen sollte geprüft werden, ob nicht auch Abschreckungsmassnahmen wirksam sind, z. B. Schnüre mit farbigen Bändern, die im Wind flattern. Feinmaschige Insektenschutznetze (Maschenweite max. 1,2 mm) wirken gegen Vögel und Kirschessigfliegen und sind kaum gefährlich. Bevorzugen Sie mehrmals nutzbare Netze.
- Seitennetze wählen: Für Reben unbedingt Seitennetze wählen. Engmaschige Netze verwenden, sie helfen auch gegen Insekten wie die Kirschessigfliege.
- Frühe Abwehr: Vogelabwehr vor Beginn der Beerenreife einrichten.
- Weiche Fäden und auffällige Farben: Netze mit weichen Fäden verwenden, helle und auffällige Farben wählen (Blau, Weiss).
- Gute Befestigung: Netze gut befestigen und spannen, auch die Kanten. Löcher schliessen, Bahnen überlappen. Es dürfen keine losen Netzteile auf dem Boden sein